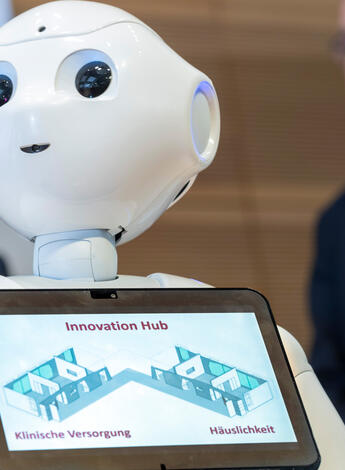Aktuell startet an den deutschen Hochschulen das vierte Corona-Semester - nach dem Wunsch von Hochschulen und Studierenden wieder mit möglichst vielen Präsenzveranstaltungen. Denn die letzten anderthalb Jahre vor dem Rechner zu Hause waren für viele nicht leicht. Wie hat das Lernen und Forschen im digitalen Corona-Semester funktioniert. Was hat gut geklappt, was weniger gut? Wie sieht es finanziell aus, wenn Studentenjobs wegfallen und Praktika nicht mehr möglich sind? Und was bedeutet es, wenn man als Doktorand plötzlich nicht mehr ins Labor darf, um an seiner Forschung zu arbeiten? Wir haben nachgefragt.
Lernorte
Studieren und Forschen während Corona

Vier Geschichten über das Lernen und Forschen in der Pandemie
Lena Rehmann ist Psychologiestudentin aus Heidelberg und hat die unterschiedlichen Erfahrungen aus der Coronakrise zum Mittelpunkt der eigenen Forschung gemacht:
„Am Anfang stand ein Gespräch mit meiner Mitbewohnerin, das mich stutzig machte. Im Lockdown, sagte sie, seien die Studierenden weniger gestresst, weil durch die Onlinelehre alles einfacher werde. In dem Moment habe ich gemerkt, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sein können – mir selbst ging es nämlich genau anders: Ich fühlte mich im Lockdown gestresster als vorher. Und so entstand die Idee, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Ich bin bei uns in Heidelberg an der Abteilung für Gesundheitspsychologie, und dort suchen wir nach Antworten auf genau solche Fragen.
Meine Dozentin hatte schon lange vor dem Lockdown die strukturellen Studienbedingungen untersucht und insbesondere nach den Ressourcen von Studierenden gefragt. Als Ressourcen bezeichnen wir bei uns in der Psychologie Faktoren, die helfen, Herausforderungen gut zu bewältigen – etwa eine hohe Selbstwirksamkeit oder psychische Gesundheit. Daran wollte ich anknüpfen: Als Fragestellung wählte ich, welche Rolle interne und externe Ressourcen beim Einfluss der digitalen Lehre an Hochschulen bezüglich Stresserleben, Zufriedenheit und akademischen Erfolgs der Studierenden spielen. Ich machte also kurzerhand die Situation, in der wir alle feststeckten, zum Gegenstand meiner Forschung.
In den folgenden Wochen entwickelte ich einen Fragebogen, mit dem sich über etliche Seiten hinweg das Befinden der Studierenden erheben lässt. Zwanzig bis dreißig Minuten dauert die Beantwortung, und zunächst habe ich viele Freunde gebeten, die Bögen einmal zur Probe durchzuarbeiten, um mögliche Fehler und Probleme zu finden. Danach habe ich ihn bundesweit an Studierende verschickt, 243 haben geantwortet. Im Mittelpunkt stand ein Vergleich zwischen Präsenz- und Onlinesemester. Eine der Fragen lautete etwa: „Sind Sie zuversichtlich, dass Sie auch im Onlinestudium komplexe Konzepte verstehen?“ Und ich überprüfte die psychologischen Anforderungen des Studiums: „In meinem Studium muss ich schnell arbeiten“ etwa lautete eine These, bei der die Befragten bewerten sollten, inwiefern sie zutrifft.
Das Ergebnis ist ein Überblick darüber, wie sich zum Beispiel das Stresserleben und die Lebens- und Studienzufriedenheit während der digitalen Lehre verändert haben. Was dabei konkret herauskam? Grundsätzlich gibt es einen Zusammenhang zwischen einer hohen Ausprägung von internen und externen Ressourcen bei Studierenden und dem erfolgreichen Umgang mit der digitalen Lehre. Generell war die Zufriedenheit signifikant geringer und das Stresserleben während des digitalen Sommersemesters 2020 signifikant höher als im Wintersemester 2019/2020 – im Durchschnitt zumindest, denn die Fälle wie meine Mitbewohnerin, der die Onlineveranstaltungen nichts ausmachen, gibt es schließlich auch.“
Lena Rehmann, 24 Jahre, ist Psychologiestudentin aus Heidelberg und wurde als Fellow im Programm „MasterLab #TheNewNormal“ vom Stifterverband und von der Heinz Nixdorf Stiftung ausgezeichnet.
Florian Puttkamer studiert im Master Chemie an der Universität Mainz und musste mitten in der Pandemie den Studienort wechseln:
„Gleich am Anfang ist mein Studentenjob weggefallen. Ich war im Nahverkehr als Fahrgastbefrager unterwegs, und als es mit Corona losging, wurden diese Umfragen natürlich gleich eingestellt. Die ersten zwei, drei Monate musste ich von meinen Rücklagen leben, auch meine Familie hat geholfen; danach habe ich zum Glück Überbrückungshilfe bekommen – Geld vom Bildungsministerium, das als Zuschuss gewährt wird. Ich muss es also nicht zurückbezahlen.
Mitten in der Pandemie habe ich meinen Studienort gewechselt: Meinen Bachelor habe ich in Köln gemacht, für den Master bin ich jetzt nach Mainz gegangen. Das hatte ich sowieso schon so geplant. Zum Glück kannte ich noch zwei Kommilitonen von früher, denn ansonsten hat man ja in einer neuen Stadt erst mal überhaupt keine Kontakte, und bei den Onlinevorlesungen lernt man natürlich auch niemanden kennen.
Ich habe versucht, aus der Not eine Tugend zu machen: Am Anfang bin ich noch eine Weile in Köln geblieben, denn von wo aus ich mich in die Vorlesungen einwähle, ist schließlich egal. Und ganz ehrlich: Bei den Vorlesungen bin ich gar nicht traurig darüber, dass sie jetzt online stattfinden, es fühlt sich entspannter an. Inzwischen bin ich aber natürlich nach Mainz umgezogen, denn Laborarbeiten gehen nun einmal nicht virtuell und bei uns gibt es im zweiten Semester ein Forschungsmodul. Vermutlich kommt jetzt im bevorstehenden Wintersemester eine Mischung aus Online- und Präsenzformaten auf mich zu. Neulich kam dazu eine E-Mail vom Uni-Präsidenten: Er schrieb uns Studierenden, dass man versuchen werde, möglichst viele Veranstaltungen im Präsenzformat durchzuführen. Mal schauen, wie sich die Lage entwickelt.
Einen Job habe ich übrigens immer noch nicht gefunden. Es sind gerade unheimlich viele Studierende auf der Suche nach einer Arbeit, weil vielen von ihnen die alten Jobs weggebrochen sind – so wie mir ja auch. Alle, die zum Beispiel in der Gastronomie gearbeitet haben, standen von einem Tag auf den anderen ohne Arbeit da. Viele haben die Überbrückungshilfe bekommen, andere konnten dank BAföG über die Runden kommen. Das hatte ich auch versucht und einen Antrag gestellt, aber leider ohne Erfolg: Ich war genau drei Wochen zu alt, um noch einen Anspruch auf BAföG zu haben.“
Florian Puttkamer, 35 Jahre, studiert im Master Chemie an der Universität Mainz.
René Rahrt promoviert in Chemie an der Universität Göttingen und musste im Lockdown seine Laborarbeit unterbrechen:
„Ohne meine Arbeit im Labor komme ich nicht weit: Ich stecke mitten in meiner Promotion am Institut für Organische und Biomolekulare Chemie an der Universität in Göttingen, und mein Thema ist so gewählt, dass ich die eine Hälfte meiner Zeit an Computerberechnungen sitze und die andere Hälfte an Experimenten im Labor. Das eine geht nicht ohne das andere. Und genau in diese Ausgangslage fiel die erste Welle der Pandemie. Die Universität reagierte sehr streng: Von Mitte März bis Ende Mai war alles dicht. Ins Labor kam man nur mit einer Sondergenehmigung, wenn es zu verhindern galt, dass ein Gerät kaputtgeht. Meine Versuche waren damit abrupt beendet, bevor sie überhaupt richtig angefangen haben.
In meiner Doktorarbeit behandle ich ein Thema aus der Grundlagenforschung. Ich lasse metallorganische Ionen in der Gasphase mit einem Substrat reagieren und leite die Geschwindigkeitskonstanten der Reaktionen ab: Wie schnell also läuft eine bestimmte Reaktion ab? Genau dafür arbeite ich am Massenspektrometer in unserem Universitätslabor. Die Ergebnisse vergleiche ich dann mit den Geschwindigkeitskonstanten, die ich zuvor am Computer theoretisch berechnet habe. Die Frage dahinter ist, wie sich die Modellierung der Reaktionen am Computer verbessern lässt – „BENCh“ heißt das Graduiertenkolleg, in dessen Rahmen ich diese Experimente durchführe.
Für mich war besonders ärgerlich, dass ich beim ersten Lockdown gerade an dem Punkt angelangt war, wo ich mit den Messungen hätte loslegen können. Im November 2019 habe ich mit der Doktorarbeit begonnen; die ersten Monate im Labor werden üblicherweise dafür genutzt, Probemessungen vorzunehmen und dabei erste Fehler zu korrigieren, um den genau richtigen Ablauf der Experimente festzulegen. Diese Phase habe ich noch vor Corona geschafft – und genau in dem Moment, als es mit den „richtigen“ Messungen losgehen sollte, kam der Lockdown.
Beim zweiten Lockdown hatten wir bei uns in der Arbeitsgruppe zum Glück ein Verfahren gefunden, um doch noch einen Präsenzbetrieb im Labor hinzukriegen: Wir haben uns in zwei Gruppen geteilt, die immer nur abwechselnd im Labor arbeiteten – damit konnten wir die Zahl der Kontaktpersonen reduzieren. Trotzdem haben wir natürlich nicht alle die Arbeiten geschafft, die eigentlich im Zeitplan vorgesehen waren. Ich gehe deshalb davon aus, dass sich meine Promotionsphase verlängern wird. Für mich war es sehr hilfreich, dass der Sprecher des Graduiertenkollegs uns immer wieder die Sorge genommen hat, dass wir nicht fertig werden könnten. Inzwischen wurde die Laufzeit unseres Projekts verlängert, einschließlich der Finanzierung.“
René Rahrt, 26 Jahre, promoviert in Chemie an der Universität Göttingen; 2019/20 war er Mitglied in der studentischen Zukunfts-AG „DigitalChangeMaker“ des Hochschulforums Digitalisierung
Markéta Křížová ist Prodekanin für Internationales an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag und muss den internationalen Austausch von Studierenden nun komplett neu organisieren:
„Wir haben gerade richtig viel Arbeit. Bei uns an der Philosophischen Fakultät stellen wir ein Viertel der gesamten Austauschstudierenden der Karls-Universität hier in Prag, und alle diese Fälle laufen über unsere Abteilung für Internationales. Wir müssen hier plötzlich Probleme lösen, die es vorher schlicht nicht gegeben hat – zum Beispiel, wenn es um Quarantäne- und Grenzbestimmungen geht. Dazu kommt die allgegenwärtige Nervosität, wenn Studierende etwa sehr schnell entscheiden müssen, ob sie nun anreisen oder nicht, weil es sonst Probleme mit dem Visum oder verschärften Einreisebedingungen geben würde. Das sind heikle und oft sehr schwierige Entscheidungen.
Wie sehr sich der Lockdown auf die Auslandsaktivitäten ausgewirkt hat, zeigen allein schon die Zahlen. Nehmen wir nur die Erasmus-Studierenden: Üblicherweise haben wir pro Jahr 300, die aus ganz Europa zu uns nach Prag kommen, und umgekehrt 300 Prager, die in eines der europäischen Partnerländer reisen. Diese Zahl hat sich während der Pandemie schlagartig halbiert.
Wir versuchen aber auch, der Pandemie und den geschlossenen Grenzen zumindest einen Vorteil abzugewinnen: Seit einigen Jahren schon arbeiten wir in einem internationalen Hochschulnetzwerk mit, zu dem neben der Universität in Prag auch die Sorbonne in Paris gehört, außerdem die Universitäten von Warschau, Kopenhagen, Mailand und Heidelberg. Dieses Netzwerk haben wir jetzt gestärkt, etwa mit gemeinsamen Onlinevorlesungen. An ihnen können Studierende aller beteiligten Hochschulen teilnehmen, sodass sie vom Know-how des ganzen Netzwerks profitieren können. Gerade denken wir darüber nach, wie wir das weiter ausbauen können – etwa durch gemeinsame Studierendenprojekte, bei denen sie virtuell in internationalen Teams zusammenarbeiten.
Die Pandemie hat aber auch die Art der Mobilität verändert. Wir haben Kontakte in alle Welt; einige unserer Studierenden etwa haben Stipendien von prestigeträchtigen Universitäten in den USA oder auch in England bekommen, konnten aber wegen der Einreiseregeln ihr Studium nicht antreten. Meiner Meinung nach lernen wir derzeit die Zusammenarbeit in der engeren Nachbarschaft hier bei uns in Mitteleuropa wieder stärker zu schätzen, mit Deutschland etwa, mit Österreich oder mit Polen. Das ist für mich eine der interessanten Entwicklungen, die während der Pandemie begonnen haben.
Unter den Studierenden ist übrigens der Hunger nach Auslandserfahrungen unverändert groß: Für das kommende Semester haben wir schon wieder so viele Erasmus-Bewerbungen wie vor der Pandemie.“
Markéta Křížová ist Prodekanin für Internationales an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag.
 [Berlin - Humboldt Universität](https://www.flickr.com/photos/20792787@N00/5017400532/) [CC BY-NC-ND 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) image](/sites/default/files/styles/780x440/public/humboldt_5017400532_a369b27bca_o_16_9.jpg?itok=9DU4wLTu)