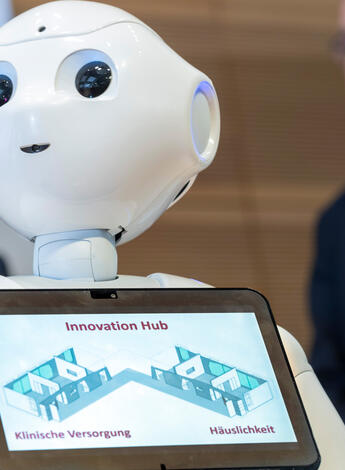Lernorte
10 Klischees über das Studieren

1. Studenten feiern viel und schlafen tagsüber.

Ein Klischee, das sich besonders hartnäckig hält. Fest steht: Studieren war noch nie ein Nine-to-five-Job. Auch wenn Studierende nur wenig Zeit in den Lehrveranstaltungen verbringen (im Schnitt 18 Stunden pro Woche), benötigen sie die meiste Zeit für das sogenannte Selbststudium: Der Lernstoff muss nachgearbeitet, Referate und Präsentationen vorbereitet, Forschungsfragen selbstständig erarbeitet und naturwissenschaftliche Versuche durchgeführt werden. Wann ein Studierender das tut, bleibt ihm jedoch selbst überlassen. Er kann sich seine Lernzeit frei einteilen. Die einen lernen lieber abends und verbringen ganze Nächte in der Bibliothek oder im Labor. Die anderen pauken zwischendurch und gehen dann abends auf eine Studentenparty. In beiden Fällen haben sie dann auch die Freiheit, morgens erst später aufzustehen.
2. Kinder aus nicht akademischen Elternhäusern oder aus Migrantenfamilien sind an der Uni fehl am Platz.

Es stimmt, dass Kinder aus nicht akademischen Familien oder aus Familien mit Migrationshintergrund seltener studieren als Sprösslinge aus einem akademischen Haushalt. Die Liste der Bedenken ist meistens lang: Das Studium ist zu teuer, dauert zu lange, ist zu schwierig, zu wenig praktisch - und keiner aus der Familie kann bei Problemen helfen. Doch Herkunft, sagt Suat Yilmaz, darf nicht über die Zukunft eines Menschen entscheiden (das ganze Interview sehen Sie hier). Yilmaz ist Talentscout an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen – einer Stadt mit hohem Arbeiter- und Migrantenanteil und einer hohen Arbeitslosenquote. Hier versucht er junge Menschen, für die Hochschule ein Fremdwort ist, für ein Studium zu begeistern und ihnen neue (Bildungs-)Wege aufzuzeigen. Yilmaz: „Vielleicht steckt in jedem dieser jungen Menschen ein grandioser Ingenieur. Wir dürfen diese Talente nicht vergeuden.“
3. Studierende liegen ihren Eltern auf der Tasche.

Sicher, der größte Anteil der Studierenden wird von den Eltern während des Studiums finanziell unterstützt - laut der letzten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks mit durchschnittlich 470 Euro pro Monat (die neue Erhebung soll im Herbst 2017 erscheinen). Etwa zwei Drittel der Studierenden gaben bei der Befragung jedoch an, ihren Lebensunterhalt mit einem Nebenjob zu finanzieren. Einer der Hauptgründe: Unabhängig von den Eltern sein zu wollen.
4. An Privathochschulen studiert nur die Elite.

Klar ist: Studieren an einer privaten Hochschule ist teurer als an einer staatlichen Universität. Durchschnittlich fallen bis zu 520 Euro im Monat an. Von den Elitekaderschmieden Harvard und Oxford, die jährlich bis zu 36.000 Euro verlangen, ist das aber noch weit entfernt. Bei der Zulassung spielen dann auch weniger die Gebühren eine Rolle als vielmehr die Frage, wie die Bewerber bei den Auswahlgesprächen, den Assessments und den Eignungstests abgeschnitten haben. Wer angenommen wird, kann die Gebühren an vielen privaten Hochschulen auch später bezahlen, wenn er nach dem Abschluss über ein entsprechendes Einkommen verfügt.
5. Stipendien bekommen nur Hochbegabte.

Das Vorurteil, Stipendien seien nur etwas für Einserschüler, hält sich hartnäckig. Sicher, die Noten spielen auch eine Rolle, aber es gibt auch andere Kriterien wie soziales Engagement oder - wie an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen - die Herkunft der Eltern oder ein Handicap wie Legasthenie. Seit 2013 vergibt die Hochschule das Stipendium fürs Anderssein. Es richtet sich an Menschen, die anders sind als der Durchschnittsstudent: Studienabbrecher, Sitzenbleiber, Legastheniker, junge Menschen, die in erster Generation studieren, oder Studienanfänger über 30. Onlineplattformen wie mystipendium.de listen dieses und Tausende andere Stipendien auf. Hier findet jeder ein passendes Stipendium.
6. Professoren interessieren sich nur für ihre Forschung und nicht für ihre Studenten.
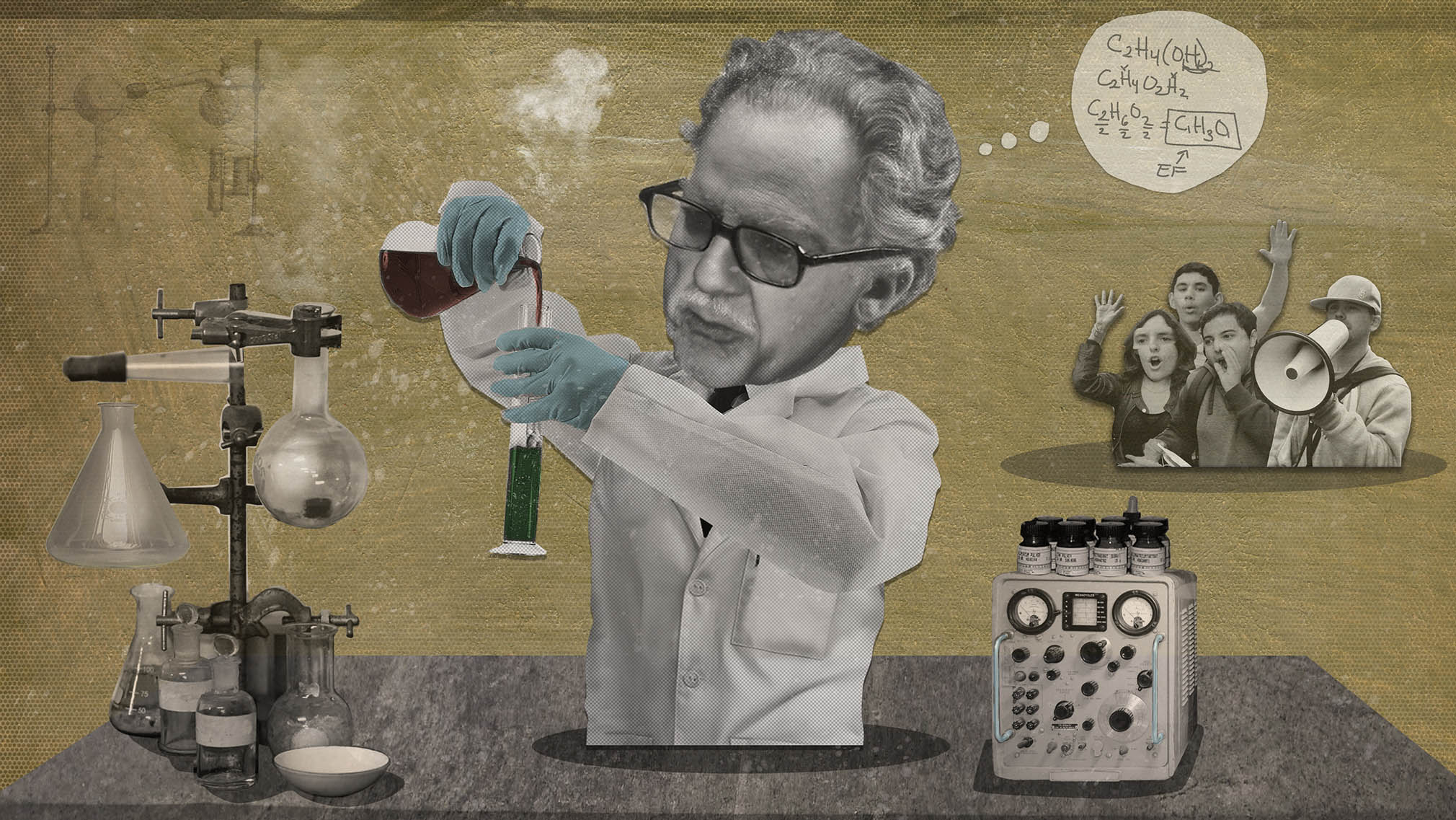
Viele Jahre stand die Lehre in Deutschland im Schatten der Forschung. Und auch heute rattern viele Professoren in ihren Vorlesungen lediglich das Skript herunter und lassen Seminare von studentischen Hilfskräften leiten, die sogar die Klausuren korrigieren. So bleibt mehr Zeit für die Forschung – und für lukrative Nebenjobs in Aufsichtsräten oder eigenen Unternehmen. Doch es gibt auch immer mehr Lehrkräfte, denen die Ausbildung des akademischen Nachwuchses am Herzen liegt und die innovative Lehrmethoden entwickeln. Die besten von ihnen zeichnet der Stifterverband jedes Jahr mit dem Ars legendi-Preis aus. 2016 ging die Auszeichnung unter anderem an Carolin Schreiber, Professorin für Industriedesign an der Folkwang Universität der Künste in Essen: „Ich habe mich immer sehr auf die Lehre fokussiert. Es macht mir einfach großen Spaß, etwas in den Köpfen der Studierenden zu bewegen.“
7. Alle Geisteswissenschaftler werden Taxifahrer.

„Und was macht man später damit?“ Eine Frage, bei der sich jedem Geisteswissenschaftler die Nackenhaare aufstellen. Es stimmt: Ein literatur- oder politikwissenschaftliches Studium bereitet in der Regel nicht auf den Arbeitsalltag in einem Großkonzern vor. Man lernt auch nicht, wie man Wunden näht, Computer programmiert oder gar Taxi fährt. Entscheidend sind vielmehr die überfachlichen Kompetenzen, die solch ein Studium vermittelt und die in zahlreichen Akademikerjobs von großer Bedeutung sind. Dazu zählen der Einsatz von wissenschaftlichen Methoden, die Fähigkeit, sich selbstständig und strukturiert in ein neues Thema einzuarbeiten und vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden, sowie kritisches und analytisches Denken. Praktische Erfahrungen lassen sich dann in Praktika sammeln - meistens leider unbezahlt. Da ist Taxifahren ein guter Nebenverdienst.
8. An der FH studieren Praktiker, Uni-Studierende pauken die Theorie.

Stöbert man durch die Jobanzeigen für angehende Ingenieure, fällt ein Kürzel besonders ins Auge: FH. Die Ausbildung an den Fachhochschulen gilt als praxisnah und weniger theoretisch als an den Universitäten und ist deshalb bei Unternehmen beliebt. Kein Wunder, wurden FHs doch mit dem Ziel gegründet, während des Studiums möglichst viel Praxis zu vermitteln. Die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge haben nun Bewegung in die Sache gebracht. Viele Universitäten haben Praktika und Praxissemester in die Curricula integriert. Und auch die Anzahl dualer Studiengänge, bei denen Hochschulstudium und Ausbildung im Unternehmen kombiniert werden, ist kontinuierlich gestiegen. Doch bei aller Praxis – im Mittelpunkt der universitären Ausbildung steht nach wie vor das eigenständige und wissenschaftliche Arbeiten. Und wer seinen Doktor machen will, kann das nur an der Hochschule: Ein Promotionsrecht für Fachhochschulen gibt es nach wie vor nicht.
9. Ohne Master ist das Studium nichts wert.

Die Bologna-Reform war ein Meilenstein im deutschen Hochschulsystem. Das Ziel: Die Studiengänge international vereinheitlichen und die Studierenden schneller fit für den Arbeitsmarkt machen. Seitdem können Studierende bereits nach durchschnittlich sechs Semestern einen akademischen Grad, den Bachelor, erwerben. Doch bereitet das kurze Studium wirklich auf das Berufsleben vor oder ist der Bachelor nur ein Abschluss zweiter Klasse? Eine aktuelle Studie des Stifterverbandes und des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt, dass Bachelorabsolventen bei den Unternehmen durchaus gut ankommen: Sie können eigenständige Projekte übernehmen und ihre Einstiegsgehälter unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der Masterabsolventen. 85,1 Prozent der Unternehmen bieten sogar die Chance, ohne Master Karriere im Unternehmen zu machen. Denn letztlich ist nicht der formale Abschluss entscheidend, sondern Leistung und Motivation.
10. Wer studiert hat, bekommt immer einen guten Job.

Rein statistisch gesehen lohnt sich ein Studium. Die Arbeitslosenquote für Akademiker liegt seit Jahren unter 3 Prozent. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist also sehr gering. Und auch die Gehälter sind im Schnitt deutlich höher. Es kommt allerdings darauf an, was man studiert: Gefragt - und gut bezahlt - sind nach wie vor Ingenieure, Maschinenbauer, Informatiker und Ärzte. Auch Wirtschaftswissenschaftler haben gute Karriereaussichten. Schlechtere Karten haben hingegen Architekten, Juristen, Naturwissenschaftler (insbesondere die Biologen) und die Geisteswissenschaftler. Hier drängen unzählige Absolventen auf den Markt bei nur wenigen freien und meist schlecht bezahlten Stellen. Noch schlimmer sieht es in der Wissenschaft aus: Hoch qualifizierte Forscher finden selten eine Vollzeitstelle an den Hochschulen und wenn doch, ist sie meist befristet.