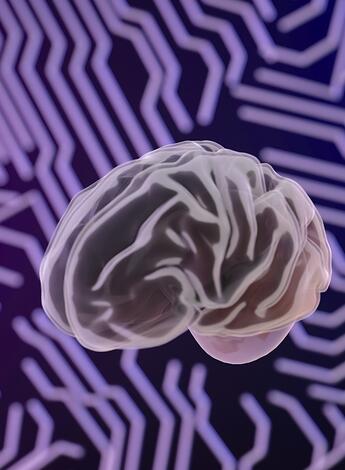Es wirkt so, als wollte uns jeder nur zu gerne das nervtötende Personalmanagement abnehmen: „No more people problems“, so wirbt Cream HR in Großbritannien mit seinem Outsourcing-Service. Und ein junges Startup begeisterte in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ die Investoren mit dem Versprechen: „Nur noch halb so viele Bewerbungsgespräche führen!“ Die Gründer hatten eine App entwickelt, die sich dank eines spontan geführten Webvideointerviews sofort einen persönlichen Eindruck von den Kandidaten verschafft; wenn das nicht passt, muss man die Person gar nicht erst einladen. Es scheint, als würde jede Form von Leistungsbewertung – sei es bei Bewerbungen, vor Mitarbeitergesprächen oder bei Beförderungen – Firmen vor Probleme stellen. Eine solche Bewertung darf natürlich nicht diskriminierend sein und sollte gleichzeitig weder zu selektiv noch zu undifferenziert vorgenommen werden. Sind die Experten aus unseren Personalabteilungen und die direkten Vorgesetzten dafür wirklich am besten geeignet?
Wenn man sich die Bestseller der vergangenen Jahre von Dan Ariely bis Daniel Kahnemann einmal näher ansieht, dann ist wohl klar, dass Menschen vor allen Dingen eins sind: irrationale Wesen mit mangelnder Entscheidungskraft. Könnten es da nicht Computer besser machen? Was hat es auf sich mit diesen Algorithmen, die versprechen, aus großen Datenmengen diejenigen Regeln zu lernen, anhand derer man die erfolgreiche Kandidatin vom Loser trennt oder den aufstrebenden Jungmanager aus einer Reihe von jungen Talenten siebt? Die Algorithmen der künstlichen Intelligenz imitieren das Lernen von Kleinkindern, die versuchen, die Regeln unserer Sprache zu entdecken: Unsere Kinder hören zu, extrahieren daraus Muster, machen Versuche, selbst zu sprechen, und binden das Feedback ihrer Umgebung in ein Update ihrer Regeln ein. Welchen Algorithmus sie dafür verwenden, wissen wir momentan nicht genau. In jedem Fall benötigen sie jede Menge „Datenpunkte“: geduldige Eltern und Großeltern, die mit ihnen in einfachen Sätzen sprechen – dies zeigt ihnen, welche Sätze richtig sind. Spätere Korrekturen der eigenen Sprachversuche verdeutlichen ihnen, welche Sätze noch nicht richtig sind: Sie bekommen ein Feedback zu dem bisher Gelernten. Sie benötigen auch eine Struktur, in der das Gelernte abgespeichert werden kann – das ist ihr Gehirn mit den sich vernetzenden Gehirnzellen.
Die moderne Informatik hat zahlreiche Verfahren entwickelt, die auf diesen vier Aspekten beruhen:
- einer großen Menge an Datenpunkten, zum Beispiel von Bewerbern der vergangenen zehn Jahre,
- einer Information darüber, wer von diesen Personen erfolgreich eingestellt werden konnte (Die große Datenmenge wird also in zwei Gruppen eingeteilt, in „erfolgreiche Bewerber“ und „nicht erfolgreiche Bewerber“. Diese Information stellt das Feedback dar, das dem System sagt, was falsch und was richtig ist.);
- auf der darauf aufbauenden Suche des Algorithmus nach Regeln, welche die erfolgreichen von den nicht erfolgreichen Bewerbern trennen helfen (Meistens beruhen diese Regeln auf reinen Korrelationen, wie etwa: „Unter den in der Vergangenheit erfolgreichen Bewerbern waren überdurchschnittlich viele mit einem BWL-Abschluss, die mindestens vier Monate im Ausland waren.“ Solche Regeln besagen natürlich nicht, dass dies notwendige Bedingungen sind, aber dass eben solche Personen später übermäßig häufig erfolgreich eingestellt werden konnten.);
- der Speicherung der Regeln in unterschiedlicher Form: als mathematische Formel, als Entscheidungsbaum oder in den viel diskutierten „neuronalen Netzen“.