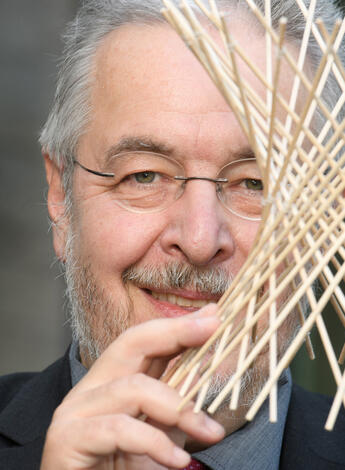Als am 22. April vor dem Brandenburger Tor rund 11.000 Menschen nach dem March for Science das Lied „Die Gedanken sind frei“ anstimmten, bekamen viele Gänsehaut. Claudio Paganini erinnert sich gut, er hatte den Berliner Ableger der weltweiten Protestbewegung mitorganisiert: „Wir Veranstalter dachten, es kommen vielleicht 2.000 Leute, und waren von der Masse völlig überrascht und geflasht.“ Alle gingen für die Freiheit der Wissenschaft und gegen Faktenleugner à la Trump auf die Straße: Wissenschaftler, Studierende, Angehörige von Hochschulen, NGOs und Wissenschaftsinstitutionen, Journalisten, Politiker, Bürger. Deutschlandweit waren es an diesem Tag an 20 Orten insgesamt 30.000 Menschen.
Wissenschaftskommunikation
Vertrauenskrise in der Wissenschaft?
/[CC0 1.0 Universal](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)) image](/sites/default/files/styles/1080x607/public/marh_for_science_flickr_cc0_1.0_universal_cc0_1.0_34225211865_9331703b81_o_16_9.jpg?itok=BMspFwQI)
Flagge zeigen für die Wissenschaft
, [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) image](/sites/default/files/styles/1080x660/public/flickr_33380271964_bd1ece6078_o_berlin_bernd_wannenmacher_lizenz_cc-by-4.0_16_9.jpg?itok=rXYHgQQZ)
Sechs Monate später lässt Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, das Ereignis auf der Konferenz „Wissenschaft braucht Gesellschaft“ im Schloss Herrenhausen in Hannover Revue passieren: „Mit der Unterstützung des March for Science haben Teile der deutschen Wissenschaft Flagge gezeigt – ich spreche bewusst von Teilen, denn natürlich ist seither auch eine Kontroverse im Gange, ob die Wissenschaft sich überhaupt in dieser Weise politisch exponieren dürfe, weil sie damit Neutralität aufgebe und angreifbar werde.“
Dieses „Unsichtbarmachen“ der Wissenschaft führt aber auch dazu, dass Deutungshoheiten den Wissenschaftskritikern unnötig überlassen werden. Das denkt auch Krull: „Der Einzug der AfD in den Bundestag ist sicher ein Zeichen dafür.“ Die deutsche Wissenschaft stecke bislang aber in keiner wirklichen Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise. Gleichwohl sei der March for Science ein Beleg dafür, wie groß der Leidensdruck inzwischen empfunden werde angesichts grassierender Faktenignoranz, Fake News, Agitation in den sozialen Medien und einer bis dato unvorstellbaren Wissenseinschränkung durch die Politik, teilweise in den USA, ganz sicher in Ungarn, so der Generalsekretär.
Viele Wissenschaftler, Wissenschaftskommunikatoren und Journalisten sind alarmiert und fürchten, dass sich die Spirale eher weiter nach unten als nach oben dreht, wenn nicht tatkräftig gegengesteuert wird. Sie sehen den March for Science als Ausgangspunkt, die Selbstkritik im Wissenschaftssystem zu pushen, und wollen auch heiße Eisen anfassen. Die kamen auf der Konferenz der VolkswagenStiftung in Hannover reihenweise zur Sprache: Warum verhindert Wissenschaft die Popularisierung gesellschaftsrelevanter Erkenntnisse? Warum publizieren Forscher lediglich in Fachmagazinen und in Fachjargon, was Laien kaum verstehen, und rümpfen gleichzeitig die Nase über die sogenannten Feuilleton-Professoren? Wie ernst ist die Dialogbereitschaft mit Bürgern gemeint, wenn Wissenschaftler diese Aufgabe den PR-Abteilungen zuschieben? Warum bringt Wissenschaftskommunikation Doktoranden keine Pluspunkte für die Karriere ein? Warum wird die qualitative Erosion in wissenschaftsjournalistischen Berichterstattungen kritisiert, gleichzeitig aber kaum neue Modelle und Vermittlungsformen ausprobiert oder finanziert, wie beispielsweise die Webpublikation The Conversation, mit der Wissenschaftler in Frankreich oder in Australien bereits durch Journalisten kuratiert Texte veröffentlichen?
Und nicht zuletzt: Wie sollte Wissenschaft generell gemacht werden, damit ihr vertraut werden kann? Warum muss vieles erst mühsam recherchiert werden, wenn man es wissen will: Drittmittelvergabe, Förderprozesse, Tierversuche oder wie Forschungsprogramme festgelegt werden?
„Das Argument, ich tue es, weil es der Forschung oder der Gesellschaft nützt, reicht nicht aus, da muss mehr kommen.“

Die sozialen Medien sind heute Kanäle, über die sich auch schlechte Erfahrungen aus dem Wissensbetrieb Bahn brechen, warnt Claudio Paganini, der als Doktorand am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam forscht, mit Herz und Seele, wie er sagt, in einem faszinierenden Beruf und Themenfeld. Er weiß aber auch: „Wenn viele, die in Labors gearbeitet haben, am Ende des Doktorats rausgehen und sagen: Ich will mit Wissenschaft nie wieder etwas zu tun haben, weil das drei Jahre Sklavenarbeit unter schlechten Bedingungen waren, vieles auch nicht so koscher war, wie es scheint, und letztendlich alles bloß auf den Publikationsindex getrimmt wurde, dann sind das relativ wichtige Kommunikatoren, die gehört werden.“
Der Ton wird nicht nur im Netz rauer, sondern auch auf dem Campus bei öffentlichen Debatten. Elisabeth Hoffmann, Pressesprecherin der Technischen Universität Braunschweig, hat es oft erlebt: „Prinzipiell sind solche kontroversen Auseinandersetzungen über wichtige Themen natürlich gut, das Problem ist aber, dass diese Diskurse sehr schnell emotional und zum Teil auch aggressiv werden können – und davor haben wir in den Universitäten eigentlich alle Angst, auch die Wissenschaftskommunikatoren, mich eingeschlossen.“ Im Kopf wüssten alle, wofür sie stehen, wofür sie eintreten, wofür sie beim March for Science auf die Straße gegangen sind, erzählt Hoffmann. „Aber wir sind noch nicht darin geübt, das wirklich mit denen zu verhandeln, die uns in der Öffentlichkeit massiv attackieren.“ Es zu können, sollte dringend trainiert werden, fordert die Pressesprecherin, da theoretisches Wissen in solch aufgeheizten Situationen kaum weiterhelfe.
Auch Annette Leßmöllmann, Leiterin des Lehrstuhls für Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Linguistik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), rät, sich mehr auf konfrontative Situationen vorzubereiten. Hierfür müsse sich jeder Wissenschaftler selbst die harten Fragen stellen, beispielsweise warum sie oder er Tierversuche in der Arbeit einsetze, zu künstlicher Intelligenz oder zum autonomen Fahren forsche. „Das Argument, ich tue es, weil es der Forschung oder der Gesellschaft nützt, reicht nicht aus, da muss mehr kommen.“ Leßmöllmann glaubt, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf habe, diese Grundannahmen oder stillen Annahmen von Wissenschaftlern, Wissenschaftsjournalisten und Forschungs-PR-Abteilungen zu erfahren. „Das heißt ja nicht, dass man sie zum Abschuss freigeben muss. Man sollte sich diese Grundannahmen aber selbst bewusst machen und dann auch gut argumentativ vertreten können.“
Ehrlichkeit weckt Vertrauen, das sagt auch Friederike Hendriks, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie in Bildung und Erziehung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster: „Wenn man Wissenschaftlern anmerkt, dass sie lediglich überzeugen wollen, wird ihnen weniger vertraut.“ Das belegen Studien. Die Wissenschaftlerin rät ihren Kollegen deshalb zu einem authentischen Dialog, in dem sie auch Unsicherheiten und die Fragilität von Wissenschaft erwähnen sollten: „Wer die Menschen nicht mit vorgefertigten Thesen abspeist, sondern klarmacht, dass sie oder er wirklich aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus argumentiert, wirkt vertrauenswürdig.“
Das fällt vielen Wissenschaftlern schwer, auch im Schriftformat, ohne den direkten Kontakt zum Bürger. Viele scheuen öffentliche Aussagen oder Auftritte in den Medien aus Angst, glaubt Carsten Könneker, der am KIT Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsforschung lehrt und Chefredakteur der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft ist: „Sie müssen in Zeitungsartikeln oder Radiointerviews plötzlich ohne ihre vertraute Fachsprache auskommen, weil sie ihnen dort wegredigiert wird.“ Wer es aber gewohnt sei, sich im Fachjargon mit Dutzenden von Fußnoten auszudrücken, fühle sich schnell unwohl bei der Vorstellung, dass diese nicht wissenschaftliche Sprache dann auch Kollegen, Assistenten und der Lehrstuhlinhaber nebenan lesen und hören.
Warum laden die Menschen überhaupt so viel Frust bei der Wissenschaft ab? Steht dieser Bereich bei Kritikern besonders in der Schusslinie?
„Wenn man Wissenschaftlern anmerkt, dass sie lediglich überzeugen wollen, wird ihnen weniger vertraut.“

Stefan Wegner steht außerhalb des Wissenschaftsbetriebs und arbeitet als Geschäftsführer der Kreativagentur Scholz & Friends für alle möglichen gesellschaftlichen Auftraggeber: Bundesministerien, die evangelische Kirche, Medienhäuser, den Deutschen Fußball-Bund. Er sagt: „Die Wissenschaft muss sich bewusst machen, dass sie als eine von mehreren Eliten in einer Vertrauenskrise steckt.“
Für Eliten sei beispielsweise die intransparente Verflechtung mit der Politik problematisch, glaubt Stefan Wegner, denn viele dieser Institutionen hingen auf direkte oder indirekte Art massiv von staatlichen Förderungen oder Steuereinnahmen ab. Damit sei die Politik der wichtigste Stakeholder der Eliten. Das führe dazu, dass sich Eliten immer stärker an den Geldgebern als an der Öffentlichkeit orientierten, auch wenn viele das bestreiten würden. Wegner: „Wenn Menschen das Gefühl haben, jemand interessiert sich nicht für ihre Interessen, sondern nur für die Interessen seiner Geldgeber, weckt das Misstrauen in der Bevölkerung.
„Die Wissenschaft muss sich zumindest in der Kommunikation von der Politik emanzipieren und runter von ihrem Schoß.“

Reformbedarf sieht der Kommunikationsexperte zudem bei der Dialogbereitschaft und einer echten Mitsprache von Bürgern: „Die Eliten haben zwar verstanden, dass man mit den Menschen reden muss, aber es gibt eine Flut von vermeintlichen Dialogformaten, bei denen letztendlich gar nicht gewünscht ist, dass der Bürger tatsächlich mitgestaltet oder mitmacht“, erklärt Wegner. Dabei sei nichts frustrierender als ein nicht ernst gemeintes Gesprächsangebot.
Damit nicht genug: „Die Wissenschaft muss sich zumindest in der Kommunikation von der Politik emanzipieren und runter von ihrem Schoß“, fordert Beobachter Wegner weiter. Das setze auch eine neue Streitbarkeit voraus, sprich: „Ich muss auch die Hand beißen, die mich füttert. Das fällt vielen schwer.“ Dazu gehöre, nicht für jeden Politiker und seine Agenda ein wissenschaftlicher Steigbügelhalter zu sein. Stichwort: Gutachten, Sachverständigenräte, Forschungskooperationen. „Wissenschaft muss deshalb auch viel härter in der kritischen und öffentlichen Beurteilung falscher oder verfälschender Veröffentlichungen sein. Bei diesem Punkt sind vor allem die obersten Köpfe der Wissenschaftsorganisationen gefragt – ich wünsche mir mehr Profil bei den Funktionsträgern an der Spitze.“
Es gibt aber noch eine weitere Dimension in der Diskussion, warum Wissenschaft und Gesellschaft sich wohlwollend näherkommen und einander mehr vertrauen sollten: Viele der großen wissenschaftlichen Themen, wie neue Energiesysteme, Mobility oder Data-based Healthcare, sind auf Daten aus der Bevölkerung angewiesen. „Wissenschaft braucht die Daten der Menschen, die Kommunikation der vielen, um neue Erkenntnisse, Wohlstand und eine Entwicklung der Gesellschaft überhaupt vorantreiben zu können“, erklärt Volker Meyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes. Dieser Aspekt sei interessant, weil dadurch Begegnungsformate zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sozusagen schon in die Herausforderungen von Innovation eingeschrieben seien: „Das müssen wir pushen, was der Stifterverband schon bald mit einem neuen Forum unter dem Titel ,Offene Wissenschaft und Innovationʻ tun möchte."
Wissenschaftsbarometer 2017
Wie groß ist das Interesse an wissenschaftlichen Themen, wie stark ist das Vertrauen in die Wissenschaft und welche Forschungsbereiche sind am wichtigsten für die Zukunft? In einer repräsentativen Umfrage ermittelt Wissenschaft im Dialog einmal jährlich die Einstellungen der Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung.