Von den Lehrkräften wird erwartet, dass sie auf den Zug aufspringen. Ein Dilemma?
In Ausnahmefällen schon. In einem Seminar traf ich einige Lehrkräfte, die sogar das Reden über Computerspiele auf dem Schulhof verbieten – wir sprechen über das Jahr 2014! Diese Verweigerung, neue Medien noch nicht einmal als Medienkritik zu thematisieren, ist sicher extrem und nicht mehr nachvollziehbar. Hier mangelt es an Medienkompetenz bei den Lehrkräften. Manche scheinen die Möglichkeiten völlig auszublenden, mit denen sie sich selbst weiterbilden könnten. Eigentlich ein No-Go für Menschen, die selbst lehren. Dieses Phänomen sieht man übrigens auch an Hochschulen. Andererseits darf man nicht übersehen, dass immer mehr Lehrkräfte Spaß an den neuen Medien haben und dieses Neuland erkunden, vor allem aus der jungen Generation.
Ersetzen digitale Lehrangebote bald Lehrkräfte?
Wohl kaum. Das menschliche Spektrum, das Kinder und Studierende zum Lernen brauchen, kann eine Computeranwendung nicht leisten, das wissen wir spätestens aus unseren Erfahrungen mit E-Learning. Es gibt diese künstliche Intelligenz noch lange nicht, die jetzt plötzlich alle Schulen und Hörsäle erobert. Wenn wir über Lernmittel sprechen, darf man die Frage aber stellen. Der Trend geht eindeutig dahin, dass digitale Lernangebote bald Schulbücher ersetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass Lehrkräfte sie engagiert mitentwickeln.
Big Data ist auch eine Form von künstlicher Intelligenz. Ergibt es Sinn, wenn Algorithmen uns demnächst Studiengänge oder Weiterbildungen vorschlagen?
Menschen per Daten auszulesen und daraus Schlüsse zu ziehen und Empfehlungen abzugeben, klingt erst einmal sinnvoll. Diese Daten müssen aber immer in irgendeiner Form vorher gelesen und bewertet werden. Auch wenn Algorithmen das tun, stehen dahinter Menschen oder Teams mit ihren eigenen Bewertungskriterien. Wenn das Ganze dann als höchste Individualisierung von Bildung verkauft wird, ist das Augenwischerei. Dieses System funktioniert nach dem Schubladenprinzip.
Träumt die Gamerszene von Studiengängen mit serious games? Man schließt sich ein paar Monate ein und erspielt sich den Bachelorabschluss.
Mindestens 99 Prozent der Gamer fänden das sicher großartig. In den USA gibt es auch schon Versuche, wie solche virtuellen Studienlabs aussehen könnten. Selbstorganisiertes Lernen wird immer beliebter, gerade Gamer beherrschen das sehr gut, was mir bei meinen Studierenden immer wieder auffällt. Die sind es gewohnt, mit Menschen rund um die Welt knifflige Spielaufgaben zu lösen, sich durch Anforderungen durchzukämpfen, am Ball zu bleiben. Das sind Kompetenzen, die sonst eher Ältere nach jahrelanger Berufspraxis haben. Die Erfahrungen unseres Lebens verändern also nicht nur unsere Fähigkeiten, sondern auch den Wunsch und die Formen, wie wir lernen wollen.
Sie sind Gamedesignerin. Bislang wird Ihr Feld als Kunstform noch eher belächelt. Ärgert Sie das?
Vielleicht ein wenig. Wir leisten hier tatsächlich noch sehr viel Pionierarbeit, aber genau das ist ja so spannend. Computerspiele sind eine neue Kunstform, eine neue Kombination aus Film und dem alten Medium Spiel. Mit Games kann man interagieren, was einen bei der ersten Begegnung dann doch überrascht. Wer Games selbst spielt, spürt, dass das etwas ganz anderes als Film ist. Wir tauchen in die Thematik ganz anders ein, beschäftigen uns damit ohne Langeweile 50, 100 Stunden. Welcher Film könnte das leisten?
Der Nutzen von Games wird zunehmend erkannt. Im Gesundheitssektor beispielsweise boomen digitale Therapieanwendungen.
Virtuelle Welten simulieren reale Erlebnisse gut. Mit Oculus-Rift-Anwendungen können beispielsweise Menschen mit Höhenangst in einen Abgrund schauen und so ihre Ängste angehen. Games lenken aber auch von der Realität ab, wie das Spiel „Snow World“, das Verbrennungsopfern hilft, ihre Schmerzen zu ertragen. Die Spieler schießen in einer blauen, kühlen Ästhetik mit Schneebällen auf Objekte, was das Schmerzempfinden tatsächlich um 30 bis 50 Prozent lindert.
Wie im Bildungsbereich auch müssen diese Games sehr verantwortungsbewusst konzipiert sein.
Das ist die große Herausforderung. Das Shooter-Spiel „Re-Mission“ ist hierfür ein gutes Beispiel. Hier reisen krebskranke Kinder durch einen virtuellen Körper und schießen auf Krebszellen. Ursprünglich sollte „Re-Mission“ die kleinen Patienten über die starken Nebenwirkungen ihrer Medikamente aufklären. Dann wurde klar, dass die Kinder es als befreiend empfanden, auf böse Krebszellen zu schießen. Sie konnten gefühlt endlich selbst etwas gegen ihre Krankheit tun. Das Konzept der Gameentwickler ging auf. Mit einem schlechten Ansatz hätte dieses Spiel aber auch nach hinten losgehen können, indem es den Lebensmut schwächt, weil den Kindern möglicherweise erst durch das Spielen ihre schwierige Situation klar geworden wäre. Wir sollten also die Wirkung von virtuellen Welten auf keinen Fall unterschätzen.
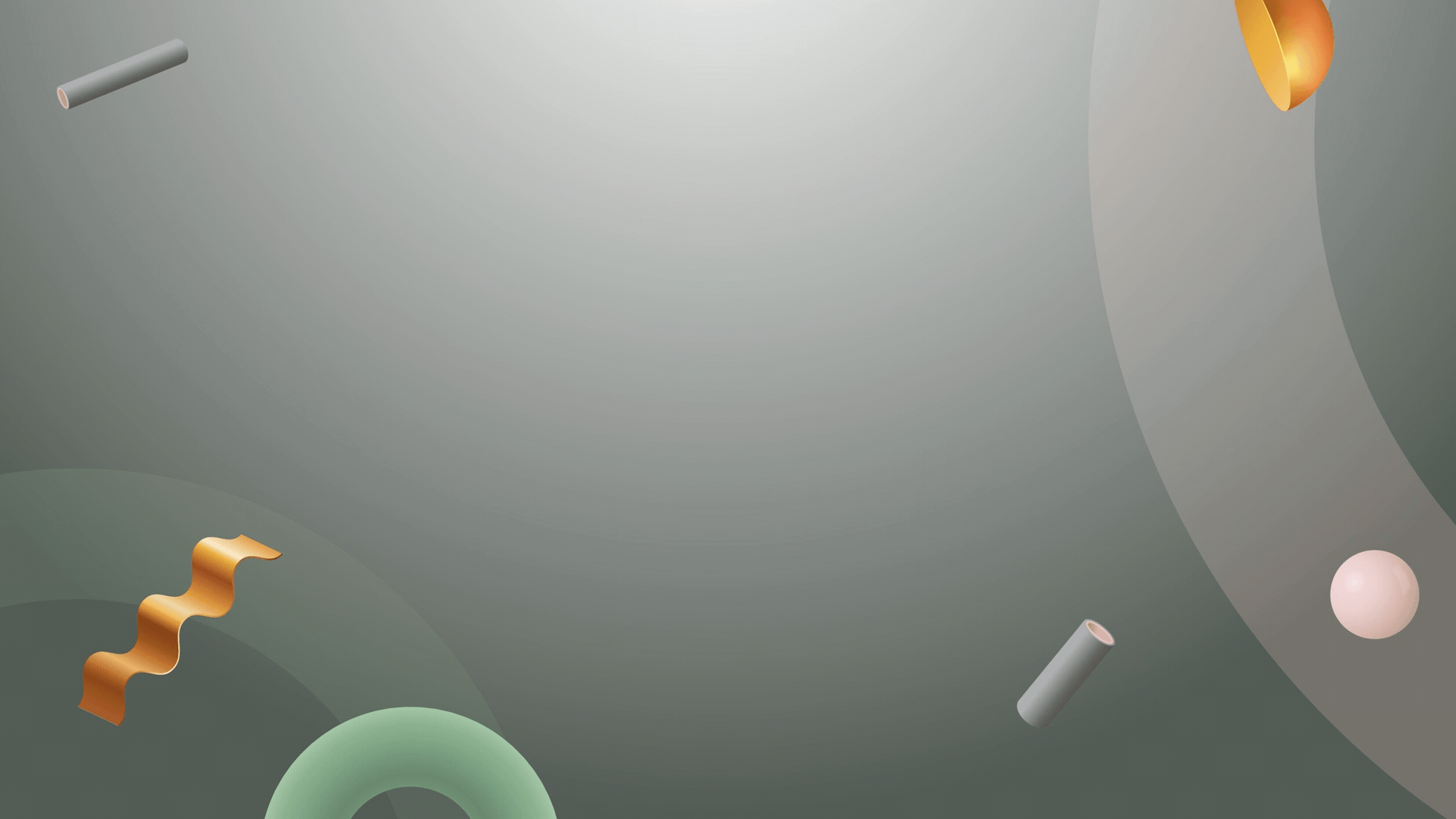
 via [flickr.com](https://www.flickr.com/photos/kwarz/13974382668/) image](/sites/default/files/styles/1080x607/public/kind_am_computer_zeitfaenger.at_16_9.jpg?itok=EdAWgSAV)






