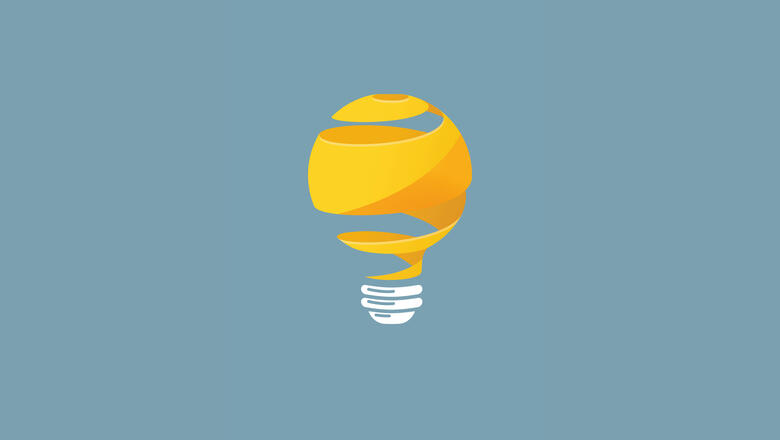Herr Meyer-Guckel, wann haben Sie zum ersten Mal bemerkt, dass sich die Welt um Sie herum beschleunigt?
Moment: Das mit der Beschleunigung ist eine These, die Sie aufstellen. Corona hat ja gerade auch vieles entschleunigt. Wer in die Geschichtsbücher schaut und sich zum Beispiel mit dem Wandel zwischen 1850 und 1930 beschäftigt, der stellt fest: Es gab immer Phasen großer Transformationen, die als Beschleunigung empfunden wurden. Manchmal hilft ein Blick zurück, um festzustellen, dass die in unserer Generation gefühlte Beschleunigung historisch nicht so einzigartig ist.
Finden Sie? Das erste Smartphone kam 2007 auf den Markt, also vor recht kurzer Zeit – und seitdem hat die Digitalisierung doch nun wirklich fast alles umgekrempelt, oder?
Was sich für den Einzelnen beschleunigt, sind Kommunikationsweisen, in die man eingebunden ist. Und das empfinden viele als Belastung. Selbstverständlich sind auch Geschäfts- und Arbeitsprozesse schneller und effizienter geworden. Was sich ökonomisch und innovationspolitisch aber grundlegend wandelt, ist etwas anderes: Die Strukturen sind viel komplexer geworden. Wer ein Auto erfinden will, kann das als Ingenieur weitgehend alleine tun. Wer aber die Mobilität neu erfinden will, muss viele Akteure – global wie regional – zusammenbringen: Da geht es nicht mehr nur um den Autobau, sondern auch um Stadtplanung, um Energieversorgung und Expertise aus vielen anderen Bereichen. Das heißt, die Transformationsprozesse, in denen wir stecken, sind vielschichtiger geworden. Und es geht nicht mehr nur um neue Technologien, sondern um einen sozialen und kulturellen Umbau. Aber auch hier gibt es Parallelen zur industriellen Revolution.
Innovationssystem
„Wir stecken mittendrin in der Transformation“

In der Industrialisierung gab es die einen, die voller Enthusiasmus in die neue Ära aufgebrochen sind, und die anderen, die sie sehr skeptisch sahen. Wie reagieren wir in Deutschland nach Ihrer Beobachtung auf den digitalen Wandel?
Viele Pionierinnen und Pioniere der industriellen Revolution kamen aus Deutschland. Bei der jetzigen, der digitalen Revolution kommen sie aus Amerika und Asien. Das muss man so trocken konstatieren. Wenn ich mir aber die jungen Leute bei uns anschaue – diejenigen, die mit allen diesen technologischen Möglichkeiten aufgewachsen sind –, dann bin ich mir sicher: Diese Generation ist ebenso zukunftsorientiert, clever und ideenreich wie vergangene Generationen auch. Bis jetzt sprechen wir nur über die Digitalisierung, aber ein weiterer Transformationsprozess hängt zum Beispiel mit dem Klimawandel zusammen. Neben der Digitalisierung ist der ökologische Wandel die Mutter aller Transformationsprozesse: Wir müssen die Grundlagen sichern, die wir für das Leben brauchen. Und daraus wiederum leitet sich eine ganze Kette von Herausforderungen ab. Wir wollen eine neue Mobilität. Wir brauchen eine neue Art der Energieerzeugung und -versorgung. Wir brauchen neue Arten des Forschens, neue Arten von Datenanwendungs- und -auswertungsprozessen. Wir wollen eine Kreislaufwirtschaft etablieren. An dieser Vielschichtigkeit sieht man schon: Das ist weder eine Frage von ausschließlich technologischen Lösungen noch von Verhaltensänderungen allein. Da fallen gesellschaftliche, regulatorische, technologische und kulturelle Prozesse zusammen; es ist hochgradig transdisziplinär und erfordert die Einbindung vieler Stakeholder. Genau das ist das Neue an der gegenwärtigen Situation.
„Neben der Digitalisierung ist der ökologische Wandel die Mutter aller Transformationsprozesse. “

Wie läuft es heute stattdessen?
Man muss einen reziproken Prozess von Fragestellungen und Lösungsansätzen unter Beteiligung vieler Stakeholder und Disziplinen organisieren. Das ist für niemanden einfach: Die Hochschulen haben dafür keine ausreichenden Ressourcen, und die Unternehmen haben bislang eher in Branchenthemen gedacht. Um noch mal das Thema neue Mobilität aufzugreifen: Heute muss sich der Autobauer mit dem Finanzdienstleister, dem Energieversorger und dem Netzbetreiber zusammensetzen und dann noch mit Firmen, die die Software liefern. Einer sitzt in Amerika, der Nächste in China, und der Dritte vielleicht irgendwo in Deutschland. Es ist nicht ganz einfach, das alles zu organisieren und dann noch verlässlich und sicher zu gestalten. Das muss auch Auswirkungen auf Wissenschaftsförderung und innovationspolitische Instrumente haben. Statt bestimmte Förderpfade vorzugeben, wie etwa „batteriebetriebene Fahrzeuge“, sollten wir Missionen und Förderziele, also etwa „nicht-fossile Antriebstechnologien“ oder „neue Mobilitätskonzepte“ festlegen und auf die kreativen Kräfte der gesellschaftlichen Akteure setzen, die unterschiedliche Wege zur Erreichung des Ziels einschlagen können. Zum anderen sollten auch Möglichkeitsräume für noch nicht erkannte Innovationsthemen und -bedarfe geschaffen werden.
„Die Kunst besteht in der Tat darin, eine Förderphilosophie aufzusetzen, die den Entwicklungen nicht hinterherläuft. “

… und ein Ansatz, der viele Förderorganisationen vor Probleme stellt, denn sie haben ja recht starre Satzungen. Wie können sie damit umgehen, dass in der Förderarbeit heute oftmals andere Ansätze nötig sind als noch vor einigen Jahren?
Die Kunst besteht in der Tat darin, eine Förderphilosophie aufzusetzen, die den Entwicklungen nicht hinterherläuft. Für uns ist unsere Jubiläumsinitiative Wirkung hoch 100 auch eine Art Suchmechanismus, mit dem wir Antworten auf genau diese Frage finden wollen.
Die Skalierbarkeit ist ein wichtiges Prinzip bei Wirkung hoch 100 – also die Möglichkeit, ein Projekt oder eine Initiative in großem Maßstab auszurollen. Können vergleichsweise kleine Organisationen wie Stiftungen mit einem speziellen und konkreten Stiftungszweck überhaupt noch einen Beitrag zu den großen Herausforderungen leisten, wenn es ihren Projekten an dieser Skalierbarkeit fehlt?
Gerade die Stiftungen, die Nischen besetzen, die niemand anders fördert, sind unfassbar wichtig. Das ist ja gerade der Vorteil von gemeinnützigem Handeln: Es kann in Bereiche gehen, in denen der Staat zu wenig tut und an die große Organisationen nicht herankommen.
Sie haben am Anfang die Parallele zur industriellen Revolution und ihren wilden Anfängen gezogen. Stecken wir bei der Digitalisierung noch in der Anfangsphase der Umwälzungen?
Durch die Pandemie hat es einen großen Sprung gegeben, was vorher als unmöglich galt, ist plötzlich selbstverständlich. Schulen haben auf Homeschooling umgestellt, Hochschulen sind routiniert bei der Onlinelehre und Unternehmen haben neue Formen des kommunikativen Austauschs und der Arbeit entwickelt. Und beim zweiten großen Thema, dem ökologischen Umbau, sind wir jetzt an dem Punkt, wo es keiner politischen Deklamation mehr bedarf. Vielen ist gar nicht bewusst, wie viel sich in der Wirtschaft bereits geändert hat: Nahezu jedes Großunternehmen hat sich ganz konkrete Ziele gesetzt, wann es die CO2-Neutralität erreichen wird. Investoren verändern ihre Anlagestrategien in Richtung Nachhaltigkeit. Ich glaube also, wir sind nicht mehr am Anfang. Nein, wir stecken mittendrin in der Transformation.
Ärgern Sie sich eigentlich manchmal, dass Sie wegen dieser Umbruchzeit auch Ihre Aufgaben immer wieder neu denken müssen?
Im Gegenteil! Ich finde es ungemein spannend, dass wir die Pfade, auf denen wir uns künftig bewegen, erst selbst noch suchen müssen. Hier beim Stifterverband sitze ich täglich mit jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, die sich zum Beispiel mit offener Innovation oder mit der Digitalisierung beschäftigen und aus früheren beruflichen Stationen dazu unglaublich produktive Erfahrungen und Kompetenzen mitbringen. Sie denken einfach neu und anders – das finde ich ungemein bereichernd. Es ist in gewisser Weise ein täglicher Jungbrunnen!
Das Interview erschien zuerst im Jahresbericht 2020/21 des Stifterverbandes.
Mehr Infos und Download