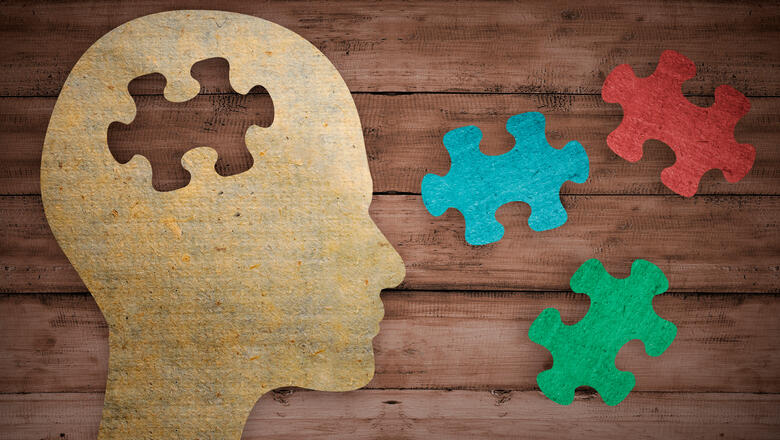Die Wirtschaftswissenschaften tragen wenig zu diesen Debatten bei. Wie ist das zu erklären? Es hängt mit dem vorherrschenden Wissenschaftsverständnis der Disziplin zusammen: Orientiert am Leitbild der Naturwissenschaft, konzentrieren sich die Wirtschaftswissenschaften auf die Produktion von Systemwissen. Basierend auf Grundannahmen zum menschlichen Verhalten (die in letzter Zeit durch Rückgriffe auf die Psychologie besser werden) und gestützt auf – in ihrer Aussagekraft in einer komplexen Welt oft beschränkte – (Gleich-)Gewichtsmodelle versuchen sie, wirtschaftliches Handeln auf Mikro- und Makroebene zu beschreiben. Damit erklären sie, wie wirtschaftliche Prozesse unter heutigen Bedingungen funktionieren. Und das auch nur unzureichend, wie die Finanzkrise 2008 gezeigt hat, die weite Teile der Wirtschaftswissenschaften genauso überraschte wie Politik und Gesellschaft.
Doch für eine Disziplin, die so entscheidend für die Gestaltung unserer Lebenswirklichkeit ist, reicht eine Beschränkung auf Systemwissen nicht aus. Als Gestaltungswissenschaft muss sich ökonomische Wissenschaft zu ihrem performativen, das heißt zu ihrem Gesellschaften prägenden Charakter bekennen. Neben Systemwissen muss sie auch Zielwissen und Transformations­wissen erzeugen.
Wirtschaftswissenschaften sollten etwas zu möglichen und wünschenswerten Zukünften sagen. Sie müssen wieder Möglichkeits­wissenschaft werden: Wie kann eine Ökonomie aussehen, die die Produktivitäts­fortschritte der Informationswirtschaft für einen Wohlstand nutzt, der bei möglichst vielen Menschen ankommt? Sind Postwachstums­gesellschaften denkbar, die dennoch eine hohe Lebensqualität für zehn Milliarden Menschen innerhalb der planetaren Grenzen schaffen? Wie sehen Entwicklungs­perspektiven für einen zeitgemäßen Kapitalismus aus?