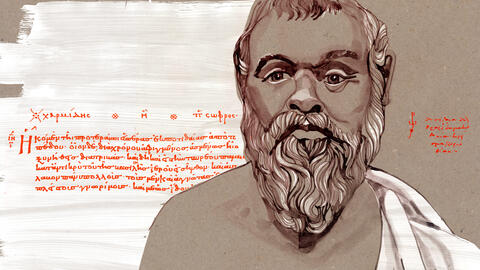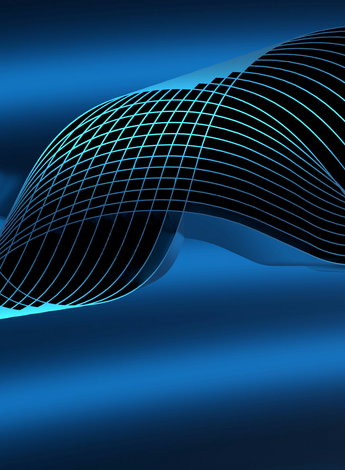Es ist nichts Geringeres als die Luft, die er atmet. So beschreibt der Biopsychologe Onur Güntürkün, was Forschungsfreiheit für ihn bedeutet. „Sie gibt mir die fantastische Möglichkeit zu erforschen, was mich interessiert. Und sie stellt sicher, dass die Wissenschaft extrem flexibel und vielseitig bleibt“, sagt Güntürkün, der an der Ruhr-Universität in Bochum lehrt, und nach einer Pause fügt er hinzu: „Deshalb ist es auch extrem wichtig, dass sie genau so erhalten bleibt und nicht eingeschränkt wird.“
Doch wenn Güntürkün seinen Kollegen zuhört, hat er manchmal das Gefühl, dass die Forschungsfreiheit in vielen Ländern längst ihre beste Zeit hinter sich hat. Dass er mit seinem ausreichend finanzierten Institut in Deutschland alleine auf einer Insel der Seligen ist. Auch die allermeisten Wissenschaftler und Forscher hierzulande beklagen schon seit Längerem, dass sie ihre Forschungsfreiheit kaum mehr richtig ausüben können. Wenig Geld, viel Zeit für die Verwaltung – von der vor allem in Deutschland einst hochgehaltenen Freiheit der Forschung bleibe nicht mehr viel übrig, beschweren sich die Professoren.
Wissenstransfer
Ist die Forschungsfreiheit in Gefahr?


Unterdrückte Forschung I: Der sich mit Stalin anlegte
Nikolai Kolzow (1872–1940), ein russischer Genetiker, leistete Widerstand gegen etwas, was seine wissenschaftliche Logik rundum ablehnte, in der stalinistischen Sowjetunion jedoch als Leitwissenschaft vorgegeben wurde: der sogenannte Lyssenkoismus. Das ist eine pseudowissenschaftliche Theorie, nach der die Eigenschaften von Organismen nicht durch die Gene, sondern durch die Umweltbedingungen bestimmt wurden. Kolzow ignorierte die Vorgaben von oben und hielt es weiter mit Darwin. Dafür wurde er schließlich vom Regime vergiftet.
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“
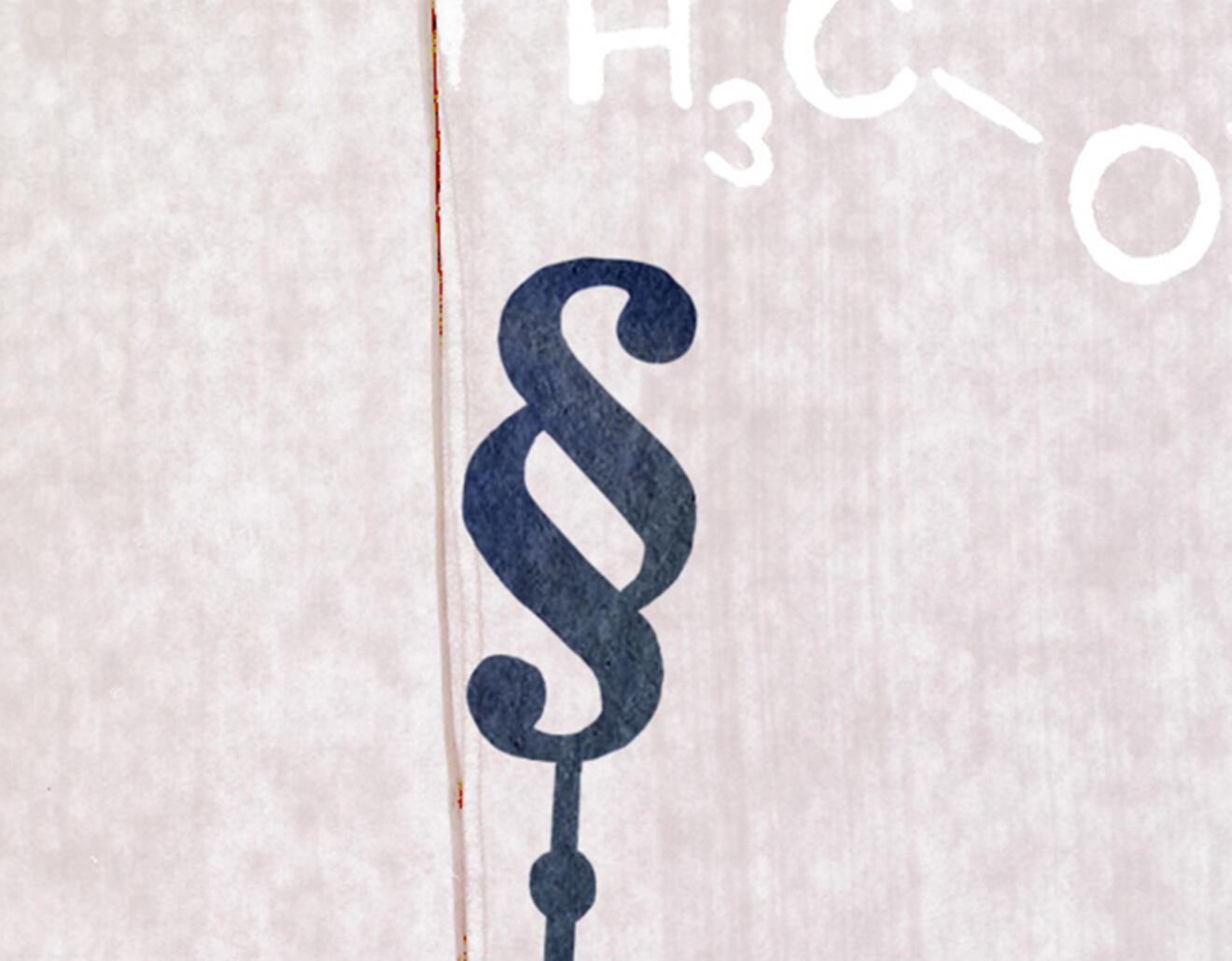
Dabei ist die Forschungsfreiheit auf den ersten Blick noch so stark wie schon 1949. Damals wurde sie ins Grundgesetz verankert, dort heißt es bis heute in Artikel 5, Absatz 3: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ Ohne diesen Satz, der unter anderem den Professoren an den deutschen Hochschulen die Freiheit der Forschung gesetzlich garantiert, stünde die Bundesrepublik vielleicht in der Qualität ihrer Wissenschaft, aber auch in ihrem Wohlstand und in ihrer Stabilität als demokratische Gesellschaft nicht dort, wo sie heute steht.
Es gibt abseits der Erkenntnismaximierung noch eine andere Rechtfertigung für die Forschungsfreiheit, eine politische. „Damit das gesammelte Wissen und die daraus resultierenden Einsichten den Bürgern als Grundlage ihrer politischen Überlegungen und Debatten etwas taugen, muss Wissenschaft in einer Demokratie frei und unbeeinflusst sein“, sagt Wilholt. Das heißt, vor allem vonseiten der Politik dürfe es keine Vorgaben oder gar Einmischung geben. Nur dann, wenn alles Wissen für alle zugänglich sei, könne jeder Bürger sich ein eigenes Bild von der Realität machen – und erst so seine Rolle als Teil einer Demokratie vollständig ausfüllen.

Unterdrückte Forschung III: „Und sie bewegt sich doch“
Galileo Galilei (1564–1642), italienischer Mathematiker, Philosoph, Physiker und Astronom, veröffentlichte 1624 seinen „Dialog über die zwei Weltsysteme“, in dem er zur Diskussion stellte, dass sich womöglich nicht alles um die Erde drehte, sondern sich die Erde – wie alle anderen Planeten – um die Sonne drehte. Daraufhin wurde ihm von der Inquisition der Prozess gemacht. Nachdem er unter Drohung mit dem Scheiterhaufen seinen „Fehlern“ abgeschworen hatte, kam er mit lebenslanger Kerkerhaft davon. Innerlich soll er seine Überzeugung, dass die Erde sich um die Sonne dreht, nie aufgegeben haben. Noch beim Verlassen das Anklagesaals, so heißt es, soll Galilei gemurmelt haben: „Und sie bewegt sich doch.“
Und doch gibt es sie noch, die Forscher, die sich nicht beklagen, sondern zufrieden sind. Darunter der Biopsychologe Güntürkün. Für ihn sind Forschungsanträge ein sinnvolles und faires Verfahren: „Geld fällt eben nicht vom Himmel, sondern ist knapp. Deshalb muss jeder seine Vorhaben den anonymen Kollegen vorlegen, um sicherzustellen, dass die Forschung relevant ist“, sagt Güntürkün. Natürlich schätzt er sich in diesem Zusammenhang auch glücklich, dass er Sekretärinnen und eine Koordinatorin hat, die ihm einen Großteil der sonstigen Verwaltungslast abnehmen.