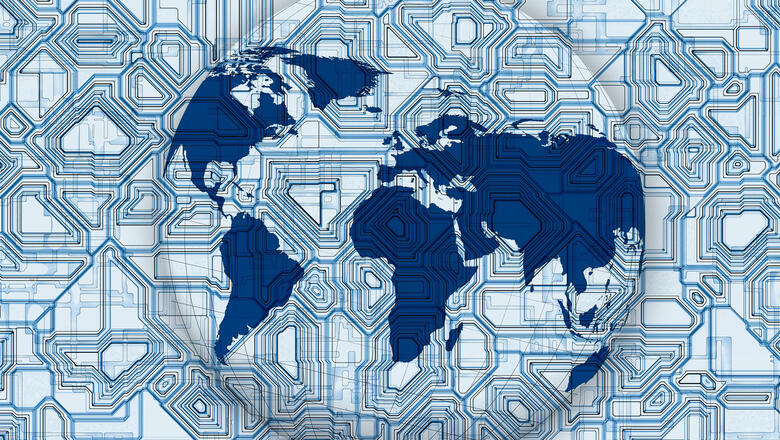Wir berichten im Bayer-Forschungsmagazin „research“ und in unseren Jahresberichten über Kooperationen, außerdem publizieren wir dazu in wissenschaftlichen Journalen wie „Drug Discovery Today“ oder „Nature Biotechnology“. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt jedoch auch Partnerschaften, die wir nicht publizieren, denn viele kleinere Projekte haben nicht unbedingt den Nachrichtenwert. Aber es kann auch patentrechtliche Gründe geben.
Eine weitere wichtige Rolle bei der Herstellung von Transparenz übernehmen unsere Kooperationspartner, die Hochschulen. Sie berichten beispielsweise im Internet ausführlich über bedeutende Kooperationen, sodass die Öffentlichkeit und die Hochschulöffentlichkeit ausreichend informiert werden.
Ein neues Hochschulgesetz hat in Bremen unlängst einen Vorstoß gemacht: Eine spezielle Datenbank für privat finanzierte Forschungsprojekte soll Drittmittelgeber benennen und auch konkrete Themen und Methoden offenlegen. Sehen Sie darin ein Hindernis für Projekte mit Bayer?
Das wäre eine Abwägungsentscheidung. Es gibt sicherlich Projekte, da wäre es unkritisch, dass das publiziert würde. Es gibt andere, da wäre das nicht der Fall. Man muss auch fragen: Wie hoch ist der administrative Aufwand, was ist der Nutzen? Ich denke, der Nutzen wäre eher gering. Ich glaube nicht, dass Datenbanken eine Antwort sind.
Haben Sie generell Verständnis für die Skepsis in Teilen der Öffentlichkeit und die Forderung nach mehr Transparenz?
Letztendlich geht es doch um den Dialog und den Austausch zu diesen Themen. Wie kann ich auf der einen Seite gewährleisten, dass die Freiheit der Forschung gegeben ist, und auf der anderen Seite aber auch, dass es einen gemeinschaftlichen Nutzen aus der Forschung für die Gesellschaft gibt? Man muss ja sehen, dass es auch einen öffentlichen Auftrag gibt: Wir investieren als Bürger über unsere Steuern in öffentliche Forschung, damit es gesellschaftlichen Fortschritt gibt. Wenn ich die Ideen der Hochschulen aber niemals in wirkliche Innovationen umsetze, dann fließt am Ende auch nichts in die Volkswirtschaft zurück. Das muss in einem offenen Dialog adressiert werden.
Wie führen Sie diesen Dialog in der Praxis?
Ich war schon oft gemeinsam mit Vertretern der Hochschulen auf Podien, wo dann auch gefragt wurde, wie unsere Interaktion konkret aussieht. Wir haben auch gemeinsam Vorträge gehalten. Das sind alles Möglichkeiten, um das Thema zu illustrieren. Man muss klarmachen, wie Kooperationen funktionieren.
Sie selbst haben an einer Forschungseinrichtung der Max-Planck-Gesellschaft promoviert und kennen beide Seiten der Medaille: Forscht man in Unternehmen anders, geht man anders mit Forschungsergebnissen um?
Nein. Gute wissenschaftliche Praxis gilt natürlich auch in der Industrie. Was mich in der Industrie damals sehr fasziniert hat, war die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dass ich mich in einem Team wiedergefunden habe, in dem ich unter anderem mit Chemikern, Bioinformatikern und Toxikologen zusammenarbeite, um innovative Lösungen zu finden. Das sehe ich nach wie vor als unsere große Stärke und erlebe in der Zusammenarbeit mit Hochschulen, dass sie diese Kompetenz sehr schätzen. Wir können andere Perspektiven einbringen und darum geht es ja. Wir arbeiten zusammen, weil wir unterschiedliche und komplementäre Stärken haben und so aus eins und eins drei machen können. Es muss einen Mehrwert geben, die Dinge zusammen zu machen, und dabei muss es auch für beide Partner einen Zugewinn geben.