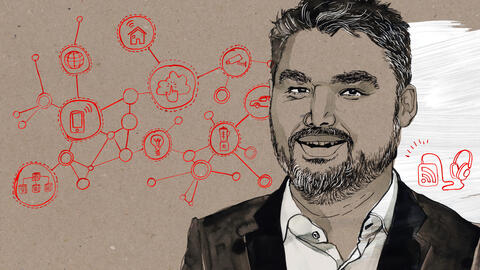Bitte nicht falsch verstehen: Ich liebe Innovationen. Ich mag die experimentelle Entstehung, das Ausprobieren, Tüfteln und den Erfolg, der hoffentlich nach langen zermürbenden Phasen in einen Geistesblitz, ein unbezahlbares Heureka Gefühl, mündet. Ich bin aber als erfahrener Innovationsmanager auch erwachsen genug, um die Grenzen und auch zum Teil die Banalität von Innovationen zu kennen und zu benennen.
Fangen wir mit der zum Teil kulthaften Verwendung des Begriffes an. Das Wort „Innovation“ hat vermutlich einen dermaßen hohen Inflationsgrad, dass Begriffe wie „Künstliche Intelligenz“ oder „Digitalisierung“ dagegen fast schon erfrischend unverbraucht und konkret wirken. Vermutlich erscheint seit Jahrzehnten kein Geschäftsbericht oder politisches Parteiprogramm mehr, ohne dass bei der Lektüre einem „Innovation“ mehrfach ins Gesicht springt. Dieses Mantra wirkt anziehend und magisch zugleich. Auf „Innovation“ ist vor allem immer dann Verlass, wenn einem sonst nichts mehr auf die Schnelle einfällt. Innovation reduziert Komplexität auf ein Minimum. Dabei ist der Begriff noch weich genug, um nicht verfänglich konkret werden zu müssen, wenn es dann wirklich mal tief in den Maschinenraum zur Umsetzung geht. Allein mit der Verwendung des Begriffes demonstriert man maximale Progressivität, ohne dabei die lästige und langwierige Pflicht der Veränderung auch wirklich vollziehen zu müssen. Innovation ist stets diffus in die Zukunft gerichtet, mehr ein Prozess als ein konkretes Ergebnis und zugleich etwas, mit dem man Probleme formidabel outsourcen kann. Ein Begriff wie geschaffen für das globale Top-Management oder die Berufspolitik, die in erster Linie Menschen tagtäglich erzählen müssen, was sie Tolles für das Morgen bewegen wollen.
Entfesselte Innovationen retten die Welt? I doubt it!

Verbote als Innovationstreiber?
Die im „Triell“ getätigte Aussage von Annalena Baerbock „Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber” wurde nicht nur durch zahlreiche Akteure aus der Wirtschaft ins Lächerliche gezogen, sondern auch so mancher „Faktencheck“ war der Auffassung, dass diese Aussage eindeutig falsch sei. Natürlich könnte man sich jetzt an den Spitzfindigkeiten der Formulierung abarbeiten, im Sinne von „Natürlich mündet nicht JEDES Verbot automatisch in eine Innovation“, doch die Mühe um Differenzierung blieb generell eher aus. Ganz im Gegenteil, der Spieß wurde einfach komplett umgedreht. Verbote, so der Tenor, würden Innovationsprozesse komplett abwürgen oder verhindern. Okay. Moment mal. War da nicht was? Allein der Blick in die Geschichtsbücher kann dabei umgehend Aufklärung verschaffen, sofern man sich unideologisch und neugierig darauf einlässt (das kann man zum Beispiel ganz transparent in diesem Podcast nachhören). Die Beispiele von innovationsfördernden Verboten sind zahlreich: Katalysator, FCKW-freie Kühlschränke, Strohhälme aus Glas oder eine Häuserdämmung ganz ohne Asbest. Es ist also aus meiner Sicht bräsige Ignoranz oder plumpe Propaganda zu behaupten, Verbote (Regularien, Regeln, Normen etc.) hätten ausschließlich negative Auswirkungen auf Innovationsprozesse.
„Wollten wir die Klimakatastrophe ernsthaft durch Innovationen bändigen, so müssen wir zwingend die anstehenden Innovationsprozesse in klare strategische Bahnen lenken. “
Doch nicht nur das. Ein weiterer Grund, warum ich es für unerträglich und unverantwortlich halte, den menschengemachten Klimawandel allein mit freier, entfesselter Innovation aufhalten zu wollen, ist die Tatsache, dass die freien, entfesselten Innovationen der jüngsten 200 Jahre uns erst den menschengemachten Klimawandel beschert haben. Die Liste der klimaschädlichen Innovationen ist nämlich noch wesentlich länger. Angefangen beim Fließband, welches uns eine Massenproduktion von vielen weiteren „innovativen“ Gebrauchsgütern für alle erst ermöglichte. „Innovativ“ war auch die Erfindung der Werbung und all ihren Spielarten, die tagtäglich dafür sorgen, die neu erfundenen Massenprodukte mit einem künstlich erschaffenen Konsumverlangen zu verkaufen. Nebenbei finanziert Werbung auch noch den Großteil unserer vierten Gewalt, den Journalismus – na, das ist doch multifunktional und praktisch, oder? Eine der größten Innovationen in Deutschland ist sicherlich immer noch das Auto. Mittlerweile ein nationales Heiligtum, in das wir lieber weiter künstliches „Bio“-Benzin mit geringem Wirkungsgrad und hohem Stromaufwand kippen wollen, statt es, wie vor hundert Jahren in den USA, mit Elektromotoren aus regenerativen Energien zu betreiben. Elektro beschleunigt zwar geil, knattert dabei aber nicht so schön. Oder man denke an all die Einweg-Produkte, die darauf optimiert werden, noch schneller kaputt zu gehen, dafür aber deren Entsorgung weder bedacht noch deren Recycling ermöglicht wird. All das hat uns die entfesselte Innovationskultur in den vergangenen Jahrzehnten beschert und ausgerechnet diese soll nun alles was sie in der Vergangenheit angerichtet hat, ohne jedwede strategische Direktive, retten? Ich wiederhole mich: I doubt it!
Fassen wir zusammen: Innovationen benötigen immer einen strategischen Rahmen. In Unternehmen wird dieser Rahmen von den Unternehmenszielen und den Shareholder Values definiert. Die Logik kapitalistischer Systeme sieht aber weder sozialen noch gemeinwohlorientierten Fortschritt vor. Es sind höchstens zufällige Abfallprodukte. Innovation hat im Unternehmenskontext nur einen einzigen Zweck: Die eigene Profitabilität nach oben schrauben. Das ist legitim. Es ist aber auch wichtig, das genau als solches zu benennen. Wollten wir die Klimakatastrophe also ernsthaft durch Innovationen bändigen, so müssen wir, aus meiner Sicht, zwingend die anstehenden Innovationsprozesse in klare strategische Bahnen lenken. Geschieht das nicht, bleibt Innovation genau das, was sie in vielen Fällen ist und immer war: Eine Zauberformel mit höchst fragwürdiger Wirkung.
(Hinweis der Redaktion: Die Texte unserer Kolumnisten geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion oder des Stifterverbandes wieder.)